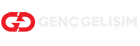Geld ist eine Methode, seine Mitarbeiter zu motivieren. Doch am wichtigsten ist die generelle Leistungsbereitschaft der Arbeitnehmer.
Für Ökonomen ist es eine Selbstverständlichkeit: Geld motiviert. Die üblichen ökonomischen Modelle gehen davon aus, dass nur derjenige engagiert und mit vollem Einsatz arbeitet, der sich davon eine optimale Vergütung verspricht. In der Sprache der politischen Propaganda heißt das dann: Leistung muss sich lohnen. Das ist nicht radikal falsch, aber es ist eine Verengung der vielen Quellen der Motivation von arbeitenden Menschen.
Wenn man die Menschen fragt, was sie antreibt, dann kommt heraus, dass nicht Geld die wichtigste Rolle spielt, sondern Faktoren, die man nicht in Euro und nicht in anderen Größen bemessen kann. Das Gehalt findet sich erst auf dem dritten Platz der Motivatoren, wie eine repräsentative Studie der Beratungsgesellschaft Hay Group feststellt. 18.000 Menschen haben sich daran in Deutschland beteiligt.
![]()
Ein “kollegiales Umfeld” und ein “erfüllender Job” motiviert die meisten Menschen mehr als ein “angemessenes Gehalt”. An vierter und fünfter Stelle folgen eine “gute Führungskraft” und “genügend Entscheidungsfreiräume”. Ein “schlechtes Arbeitsklima” , eine “Aufgabe, die keinen Spaß macht”, und eine “schlechte Führungskraft, die mich nicht fördert und mich nicht fair behandelt”, sind dementsprechend die wichtigsten Kündigungsgründe. Erst an vierter Stelle kommt ein “zu niedriges Gehalt”. Managementberater und Buchautor Reinhard Sprenger (“Mythos Motivation”) dürfte sich bestätigt fühlen. Er rät Arbeitgebern von Geld als Lockstoff ab: “Wer für Geld kommt, geht auch für Geld.”
“Wer für Geld kommt, geht auch für Geld”
Aus Sicht der Controler und Finanzvorstände ist das eine gute Nachricht. Unternehmen müssen also nicht zwingend mehr Geld bieten, um ihre Mitarbeiter zu mehr Leistung zu motivieren. Zufriedenheit ist ihnen lieber. Aber was können Arbeitgeber tun, um die herzustellen?
Eine altbewährte und zudem besonders preiswerte Art seine Mitarbeiter zu motivieren, ist Lob: Ein gut formuliertes, persönliches Kompliment, ein handgeschriebener Zettel, ein kurzer Anruf, vielleicht in der richtigen Situation sogar ein Schulterklopfen.
Norihiro Sadato vom National Institute for Physiological Sciences glaubt, dass Komplimente mindestens ebenso anspornen wie Geld. In seinem Experiment sollten 48 Probanden ihre Fingerfertigkeiten auf einer Tastatur perfektionieren und dazu neue Techniken üben. Anschließend wurden sie in drei Gruppen unterteilt: In der ersten wurde jeder Teilnehmer für seine jeweiligen Lernerfolge individuell mit einem Kompliment bedacht. In der zweiten Gruppe sahen die Probanden zu, wie einem anderen Teilnehmer ein Kompliment gemacht wurde. Die dritte Gruppe wiederum sah sich die Gruppen-Lernerfolge nur als Grafik an.
Als die Probanden das Gelernte zeigen sollten, schnitt die erste Gruppe der individuell Gelobten mit Abstand am besten ab. Sadato erkennt darin eine stimulierende Wirkung von Lob auf spätere Leistung. Er ist nicht der erste Psychologe, der solche Beobachtungen machte. Albert Bandura, einer der berühmtesten Vertreter seiner Zunft, hat beobachtet, dass gelobte Menschen sich höhere Ziele stecken und sich diesen stärker verpflichtet fühlen, als ungelobte.
Übersicht zu diesem Artikel
Wahre Motivation kommt von innen
In einem Experiment hat das der Verhaltensökonom Dan Ariely bestätigt: Seine Probanden sollten Lego-Männchen zusammenbauen. Die eine Gruppe tat das für abnehmende Belohnungen – erst gibt es 2 Dollar für eins, dann nur noch 1,89, und immer weniger. Die zweite Gruppe baute ihre Männchen für ansteigende Belohnungen zusammen. Allerdings wurden ihre Männchen sofort vor ihren Augen zerstört. Die erste Gruppe war deutlich produktiver, die zweite hörte bald auf – trotz steigender Belohnungen.
Aber so gut man auch lobt, die einzige wirkliche Quelle der Motivation stecke nur in jedem selbst, sagen viele Psychologen. Man kann Menschen nicht zu etwas motivieren, wozu sie aus sich selbst heraus keine Lust mehr haben, schreibt auch Managementberater Sprenger. Er rät daher von jedem Versuch ab, die Befindlichkeit seiner Mitarbeiter zu beeinflussen. Sein Argument: Das sei eigentlich nur eine Form von Manipulation und Beleg für eine Misstrauenskultur, in der die Vorgesetzten glaubten, dass sie ihre faulen Untergebenen ständig antreiben müssten.
Und umgekehrt: Wer mit der Einstellung arbeitet, ständig von seinem Chef motiviert werden zu wollen, gibt letztlich zu, dass er wie ein Windhund zum Laufen eine Hasenattrappe vor der Nase braucht. Echtes Engagement lasse sich nun mal nicht kaufen, sagt Sprenger. Weder durch Geld, noch durch andere Währungen.
Wirklich motivieren können Führungskräfte demnach nicht, aber sie können demotivieren. Das zu verhindern ist daher nach Sprengers Ansicht entscheidend. Fußballtrainer-Legende Giovanni Trapattoni brachte es auf eine einfache Formel: Ein guter Trainer kann eine Mannschaft um zehn Prozent verbessern; ein schlechter macht sie 50 Prozent schlechter.
Die grundsätzliche Leidenschaft und Leistungsbereitschaft muss stets vom Mitarbeiter selbst kommen. Im Fachjargon heißt das “intrinsische Motivation”. Sie ist nach Ansicht von Psychologen umso höher, je mehr die persönlichen Stärken und Vorlieben mit den beruflichen Aufgaben übereinstimmen. Angestellte, die häufig über die Firma oder ihre Aufgaben klagen, verdrängen damit also womöglich nur, dass sie einst den falschen Beruf oder den falschen Arbeitgeber gewählt haben.
Fordern statt Verführen
Vorgesetzten sollte also immer daran gelegen sein, optimale Bedingungen für jeden ihrer Mitarbeiter zu schaffen. Das sind immer Bedingungen, in denen sich dessen intrinsische Motivation entfalten kann. Das heißt, eine vertrauensvolle und fordernde Führung ist gefragt, aber vor allem: passende Aufgaben und Freiräume. In imaginären Fußfesseln arbeitet niemand engagiert.
Entscheidungsspielräume sind für die Motivation zentral, wie die Global Workforce-Studien der Beratungsgesellschaft Towers Watson immer wieder belegen. Deren Quintessenz lautet: Chefs sollten ihre Mitarbeiter machen lassen, statt allzu viel zu kontrollieren. Sie sollten fordern statt verführen. Je größer die Freiheit der Beschäftigten und je höher der damit verbundene Anspruch an die Mitarbeiter, desto besser werden die Stimmung im Büro und die Arbeitsergebnisse sein. Psychologen nennen dies des Pygmalion- oder Rosenthal-Effekt: Die positiven Erwartungen eines Lehrers oder Vorgesetzten haben einen positiven Einfluss auf die Leistungen des Schülers oder Mitarbeiters.
Wer geschätzt wird, arbeitet motivierter
Das Schlimmste was ein Chef tun kann, um die Motivation und vor allem die Loyalität eines Mitarbeiters zu zerstören, ist ihm zu signalisieren: Sei froh, dass Du hier arbeiten darfst. Wer glaubt, dass der Erhalt des Arbeitsplatzes allein schon ein Leistungsanreiz sei, der kündigt seinem Mitarbeiter den “psychologischen Arbeitsvertrag”, den dieser nur so lange für gültig betrachtet, wie er sich nicht als Gnadenbrotempfänger behandelt sieht. Solch ein Mitarbeiter identifiziert sich nicht mehr mit seiner Firma und kündigt bei erstbester Gelegenheit auch den tatsächlichen Arbeitsvertrag. Wenn ein Chef es schafft, dass keiner seiner Mitarbeiter innerlich kündigt, hat er wahrscheinlich schon ziemlich viel erreicht.
Quelle: http://www.zeit.de/karriere/beruf/2012-12/personalfuehrung-motivation-mitarbeiter